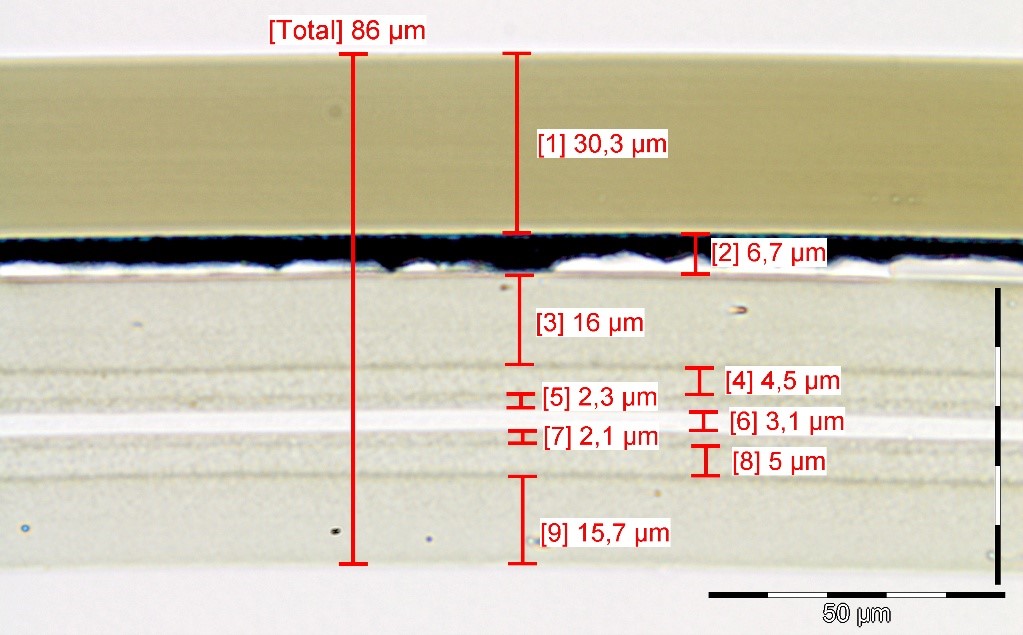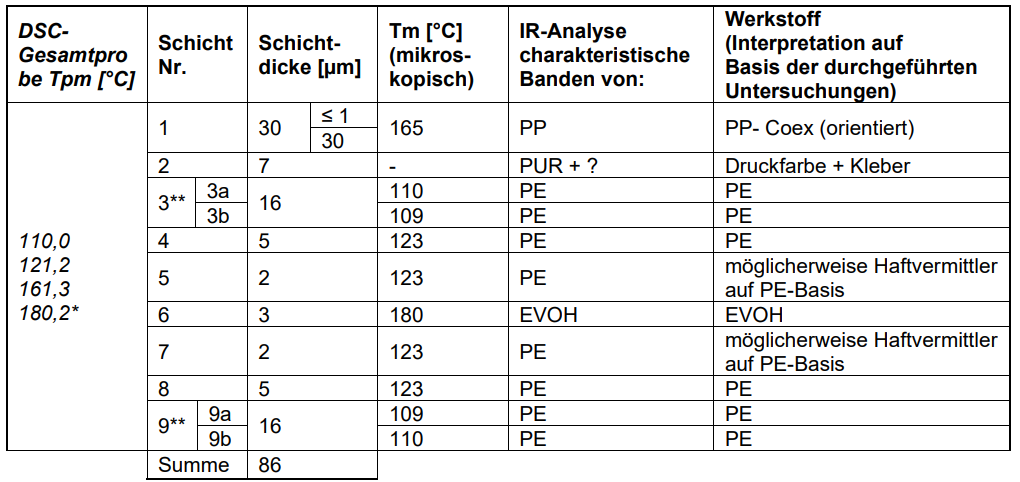Künstliche Bewitterung von Folien und Papieren dem Q-UV-Gerät zur Überprüfung der Witterungsbeständigkeit.
Die künstliche Bewitterung ist eine unverzichtbare Methode zur Bewertung der Langzeitbeständigkeit von Kunststoffen und zur Sicherstellung ihrer Witterungsbeständigkeit. Mithilfe moderner Prüfgeräte, wie dem Q-UV-Gerät, können Schäden durch UV-Strahlung und Feuchtigkeit gezielt simuliert werden. Durch normgerechte Verfahren nach DIN EN ISO 4892-3 und DIN EN 14932 lassen sich realistische Alterungsprozesse effizient nachbilden. Besonders für Anwendungen in Bau-, Automobil- und Agrarindustrie bietet diese Methode wesentliche Erkenntnisse. Die Ergebnisse unterstützen dabei maßgeblich Produktentwicklung und Qualitätssicherung.
Die künstliche Bewitterung von Kunststoffen ist ein wesentlicher Bestandteil der Materialprüfung. Sie dient der Beurteilung der Langzeitbeständigkeit von Werkstoffen unter dem Einfluss von UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Temperatur, wodurch ihre Witterungsbeständigkeit überprüft wird. Während Prüfverfahren mit Xenonbogenlampen ein breites Lichtspektrum nachbilden, ermöglichen UV-Leuchtstofflampen gezielte Untersuchungen im kurzwelligen UV-Bereich.
Mit der Erweiterung um ein Q-UV-Gerät können nun normgerechte Prüfungen nach DIN EN ISO 4892-3 und DIN EN 14932 durchgeführt werden. Diese Normen legen Prüfverfahren für die künstliche Bewitterung von Kunststoffen mit UV-Strahlung und Feuchtigkeit fest. Das Verfahren ist insbesondere für Anwendungen relevant, bei denen Kunststoffe intensiver Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, wie z. B. im Bauwesen, in der Automobilindustrie oder insbesondere in der Landwirtschaft, um ihre Witterungsbeständigkeit zu testen.
Das Q-UV-Prüfgerät simuliert die schädigende Wirkung von UV-Licht und Feuchtigkeit durch zyklische Belastung der Proben. Zum Einsatz kommen UV-Leuchtstofflampen, die in definierten Wellenlängenbereichen emittieren. Strahlung im UV-Bereich hat eine hohe Energiedichte und ist in der Lage, molekulare Bindungen in Kunststoffen aufzubrechen. Dieser Prozess führt zu Versprödung, Verfärbung oder Verlust der mechanischen Eigenschaften, die die Witterungsbeständigkeit beeinträchtigen.
Zusätzlich zur UV-Bestrahlung wird die Materialprobe in periodischen Abständen Feuchtigkeit in Form von Kondenswasser oder Sprühnebel ausgesetzt. Diese zyklische Kombination von Strahlung und Feuchtigkeit ermöglicht eine realistische Alterungssimulation, die für verschiedene Materialklassen von hoher Relevanz ist, und ebenso die Witterungsbeständigkeit testet.
Vorteile und Anwendungsbereiche
- Präzisere Alterungssimulation: Durch gezielte UV-Bestrahlung können spezifische Schadensmechanismen untersucht werden.
- Normgerechte Prüfverfahren: Erfüllung der Anforderungen gemäß DIN EN ISO 4892-3 und DIN EN 14932.
- Vergleichbarkeit mit natürlichen Bewitterungstests: Die künstliche Bewitterung ermöglicht eine beschleunigte Bewertung, deren Ergebnisse mit Freilandtests korreliert werden können.
- Breites Anwendungsspektrum: Die Methode ist für Kunststoffe, Lacke, Beschichtungen und andere polymere Werkstoffe geeignet.
Die Erweiterung der Prüfkapazitäten durch Q-UV ergänzt bestehende Methoden der künstlichen Bewitterung und ermöglicht eine detaillierte Bewertung der Materialalterung unter spezifischen Bedingungen. Diese Erkenntnisse sind sowohl für die Produktentwicklung als auch für die Qualitätssicherung in verschiedenen Industriezweigen von entscheidender Bedeutung, besonders für die Bewertung der Witterungsbeständigkeit.
Weitere Prüfungen zu diesen Themengebiet finden sie hier