Thomas Gradl (Dipl.-Ing. FH) studierte an der Fachhochschule Rosenheim Kunststofftechnik und arbeitete danach 15 Jahre im Vertrieb bei einem Maschinenbauer für Peripheriegeräte für Kunststofftechnik, Schwerpunkte Trocknen und Fördern von Kunststoffgranulaten. Seit fünf Jahren ist er im Vertrieb Bayern bei der Firma Eltex Elektrostatik tätig. Er berät Kunden im Bereich Erdung, Erdungssysteme für passive und aktive Überwachung und bei elektrostatischen Problemen oder Nutzanwendungen der Elektrostatik (Aufladung). Außerdem arbeitet er Lösungen zur Integration in vorhandene oder neu zu konzipierende Anlagen aus.
Sie referieren über “Statische Aufladung verstehen und beherrschen, um Barriere zu garantieren”. Was bewegt Sie besonders in diesem Zusammenhang?
Ich möchte ein Gespür für das Problem der statischen Aufladung wecken; oft wird diese nicht erkannt und viel Zeit verschwendet, um andere angebliche Ursachen zu beseitigen.
Welche großen Fehler werden Ihrer Meinung nach in puncto statischer Aufladung immer wieder begangen?
Entweder wird sie nicht erkannt oder aber überall gesehen. Diese beiden Extreme führen zum Teil zu abenteuerlichen Auswüchsen. Da werden Folien von Hand gereinigt, wo man mit Entladung einen Großteil der Staubanziehung verhindern könnte. Andererseits gibt es Betriebe, in denen an allen Ecken und Enden entladen wird, wobei mindestens die Hälfte der Ionisatoren überflüssig ist. Statische Ladung soll man dort entfernen, wo sie stört, und dieses mit Maß und Ziel.
Barriereverpackungen bieten einen Schutz vor unerwünschter Kontamination der verpackten Lebensmittel. Das ist ein Beitrag zum Wohlstand und ermöglicht flächendeckende Versorgung mit Lebensmitteln. Trotzdem stehen immer mehr Verbraucher Plastikverpackungen kritisch gegenüber und verpackungsfreie Supermärkte schießen wie Pilze aus dem Boden. Wie sehen Sie diesen Trend hinsichtlich Ihres Vortrages?
„Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass“. Wir sind es gewohnt, verschiedenste Produkte immer und zu jeder Zeit frisch und über lange Zeit haltbar zu kaufen. Andere Produkte sollen möglichst lange gelagert werden und dabei ihre Eigenschaften nicht verlieren. Mag sein, dass sich der ein oder andere auf verpackungsfreie Produkte besinnt, im Großen und Ganzen wird sich der Großteil der Menschen aber nicht freiwillig umstellen. Dieses wäre auch mit Kosten und damit steigenden Preisen verbunden, der schmerzhaftesten Stelle des Verbrauchers. Selbst wenn sie beim Dorfmetzger, der nicht alles selbst herstellen kann, um alle Kundenwünsche zu befriedigen, bestimmte Produkte kaufen, so kommen diese in einer Barrierefolie verpackt zu ihm geliefert und werden dann dort schön in die Auslage drapiert. Kritisch darf man schon sein, aber bitte konsequent zu Ende denken und auch Verzicht üben können.
Wo sehen Sie für Packmittelhersteller – insbesondere solche, die hochwertige Barrierematerialien produzieren – besonderen Handlungsbedarf, damit Verpackungen beim Endverbraucher mehr Akzeptanz erfahren?
Zur Steigerung der Akzeptanz muss die Verpackung wirklich hochwertig sein. Ich persönlich finde es ärgerlich, wenn sich beim Öffnen von Verpackungen die Oberfolie nicht an der Schweißnaht löst, sondern die Deckfolie irgendwie quer einreißt. Es hinterlässt zumindest bei mir einen faden Nachgeschmack, ein minderwertiges Produkt gekauft zu haben.
Ebenso ist die Fähigkeit zum Recycling sehr wichtig. Fragen Sie mal einige Leute, warum sie Kaffeekapseln aus Alu denen aus Kunststoff bevorzugen, obwohl diese teurer sind. Das ökologische Gewissen des Verbrauchers wird angesprochen, man hat den Eindruck Alu-Kapseln sind besser, weil diese zu einem höheren Prozentsatz recyclingfähig sind.
Unterverpackungen können bis hin zu Rechtsstreitigkeiten führen, Überverpackungen verursachen unnötige Kosten und Ressourcenverschwendung. Welche Voraussetzungen muss der Packmittelhersteller erfüllen, um ein gesundes Mittelmaß zu finden?
Kommunikation und enger Kontakt mit seinem Kunden muss da sein, damit auch wirklich die maßgeschneiderte Verpackung für das Produkt entstehen kann. Auch das Wissen um die Eigenschaften seiner Barrierefolien und die Verarbeitung und Produktion müssen qualifiziert sein, das höchstmögliche aus den Rohstoffen herauszu- holen. Dieses funktioniert nur mit engagierten und qualifizierten Mitarbeitern, die wissen, worauf es bei den Produkten auch beim Endverbraucher ankommt.
Welchen Beitrag leisten aus Ihrer Sicht Hochbarriereverpackungen zur Nachhaltigkeit?
Ganz einfach, die verpackten Produkte halten länger und können auch länger gelagert werden. Wenn dann die Verpackung auch noch recyclefähig ist, was will man mehr?
Bei welchen Verpackungen wird es Ihrer Meinung nach mit der Barriere übertrieben und warum?
Eine generell übertriebene Verpackung ist mir mal am Obststand im Supermarkt aufgefallen, da waren Bananen in Folie eingeschweißt ….
Wo sehen Sie in naher Zukunft bahnbrechende Innovationen im Verpackungsbereich insgesamt und bezogen auf Barriere im Speziellen?
Zum Beispiel Reifung von Fleischwaren in Vakuumverpackungen. Der Reifungsprozess passiert hier auf dem Weg zum Kunden. Wird in vielen Ländern bereits praktiziert und akzeptiert, die deutschen Verbraucher tun sich hier noch etwas schwer.
Ebenso sehr interessant finde ich das Verfärben von Kunststoffmaterialien, wenn das Produkt nicht mehr in Ordnung ist oder die Schutzatmosphäre in der Verpackung nicht mehr gegeben ist. Der Verbraucher sieht dann optisch und nicht nur auf Grund eines Mindesthaltbarkeitsdatums, ob die Ware noch in Ordnung ist.
Wofür begeistern Sie sich neben Ihren beruflichen Aufgaben?
Für meine Bienen, für mein Motorrad und für meine Schreinerwerkstatt.




 Essen Sie noch Bioprodukte oder schon vegan? Kaufen Sie Ihr Müsli beim Discounter oder bestellen Sie Ihr Designmüsli schon im Netz? Machen Sie eine Medien- oder Plastikdiät oder wollen Sie tatsächlich noch an Gewicht abnehmen?
Essen Sie noch Bioprodukte oder schon vegan? Kaufen Sie Ihr Müsli beim Discounter oder bestellen Sie Ihr Designmüsli schon im Netz? Machen Sie eine Medien- oder Plastikdiät oder wollen Sie tatsächlich noch an Gewicht abnehmen? Ich denke, es wird dringend Zeit, auch auf internationaler Ebene als Packmittelindustrie – sogar unabhängig vom Packstoff – eine klare Aussage zu erarbeiten, die deutlich macht, welchen Nutzen Verpackungen stiften und welche Hausaufgaben noch vor uns liegen. Ansätze wie der
Ich denke, es wird dringend Zeit, auch auf internationaler Ebene als Packmittelindustrie – sogar unabhängig vom Packstoff – eine klare Aussage zu erarbeiten, die deutlich macht, welchen Nutzen Verpackungen stiften und welche Hausaufgaben noch vor uns liegen. Ansätze wie der 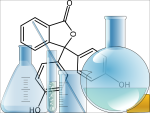 Bei chemischen Kreisläufen hält man die Zahl der eingesetzten Chemikalien gering und vor allem unter stetiger Kontrolle. Ein Beispiel dafür ist, dass Kunststofffenster verliehen werden und der Produzent diese nach einer vereinbarten Laufzeit wieder zurückerhält, um daraus wieder Kunststofffenster herzustellen. Das hat mehrere Vorteile:
Bei chemischen Kreisläufen hält man die Zahl der eingesetzten Chemikalien gering und vor allem unter stetiger Kontrolle. Ein Beispiel dafür ist, dass Kunststofffenster verliehen werden und der Produzent diese nach einer vereinbarten Laufzeit wieder zurückerhält, um daraus wieder Kunststofffenster herzustellen. Das hat mehrere Vorteile: Hier spielt die Natur die dominierende Rolle, auch wenn der Mensch ihr dabei gehörig ins Handwerk pfuschen wird. Wir nutzen die Natur – z. B. Pflanzen – um Rohstoffe zu gewinnen, die wir der Natur wieder zurück geben können. Also nicht nur Biopolymere, die aus Pflanzen stammen, sondern eben auch solche, aus denen wieder Pflanzen wachsen können. Also bio-basierte (bio-based) Materialien, die aber auch bioabbaubar (bio-degradable) sind. Der große Vorteil dieser Polymergruppe besteht darin, dass man sie so designen könnte, dass sie auch ohne funktionierende Sammel- und Entsorgungssysteme in die Natur „entlassen“ werden, wieder nutzbringend sind und nicht hunderte von Jahren in Meeren treiben und Fische malträtieren.
Hier spielt die Natur die dominierende Rolle, auch wenn der Mensch ihr dabei gehörig ins Handwerk pfuschen wird. Wir nutzen die Natur – z. B. Pflanzen – um Rohstoffe zu gewinnen, die wir der Natur wieder zurück geben können. Also nicht nur Biopolymere, die aus Pflanzen stammen, sondern eben auch solche, aus denen wieder Pflanzen wachsen können. Also bio-basierte (bio-based) Materialien, die aber auch bioabbaubar (bio-degradable) sind. Der große Vorteil dieser Polymergruppe besteht darin, dass man sie so designen könnte, dass sie auch ohne funktionierende Sammel- und Entsorgungssysteme in die Natur „entlassen“ werden, wieder nutzbringend sind und nicht hunderte von Jahren in Meeren treiben und Fische malträtieren. Momentan favorisieren viele die Mischung aus beiden Kreisläufen mit mehreren möglichen Abzweigungen in andere Kreisläufe, aber eben auch in Sackgassen wie die Verbrennung. Wird beispielsweise ein Biomaterial verbrannt, bleiben zwar seine kleinsten Bausteine (Atome) in Form von Abgas und Schlacke erhalten, diese werden aber nur bedingt wieder zu Pflanzen wachsen können, aus denen wir wieder Biokunststoff gewinnen. Aus den Abgasen (z. B. Kohlendioxide etc.) kann man sich das noch zum Teil vorstellen. Aus der Schlacke aus unseren Hochöfen oder Zementwerken eher nicht, da sie unkontrolliert kontaminiert sind. Wir wissen einfach zu wenig über das, was drin ist und noch weniger darüber, wie es wechselwirkt. Das ist eine Sackgasse, schont aber auch die Ölreserven in doppelter Hinsicht – beim Rohstoff, da Bio und bei der Energiegewinnung.
Momentan favorisieren viele die Mischung aus beiden Kreisläufen mit mehreren möglichen Abzweigungen in andere Kreisläufe, aber eben auch in Sackgassen wie die Verbrennung. Wird beispielsweise ein Biomaterial verbrannt, bleiben zwar seine kleinsten Bausteine (Atome) in Form von Abgas und Schlacke erhalten, diese werden aber nur bedingt wieder zu Pflanzen wachsen können, aus denen wir wieder Biokunststoff gewinnen. Aus den Abgasen (z. B. Kohlendioxide etc.) kann man sich das noch zum Teil vorstellen. Aus der Schlacke aus unseren Hochöfen oder Zementwerken eher nicht, da sie unkontrolliert kontaminiert sind. Wir wissen einfach zu wenig über das, was drin ist und noch weniger darüber, wie es wechselwirkt. Das ist eine Sackgasse, schont aber auch die Ölreserven in doppelter Hinsicht – beim Rohstoff, da Bio und bei der Energiegewinnung.